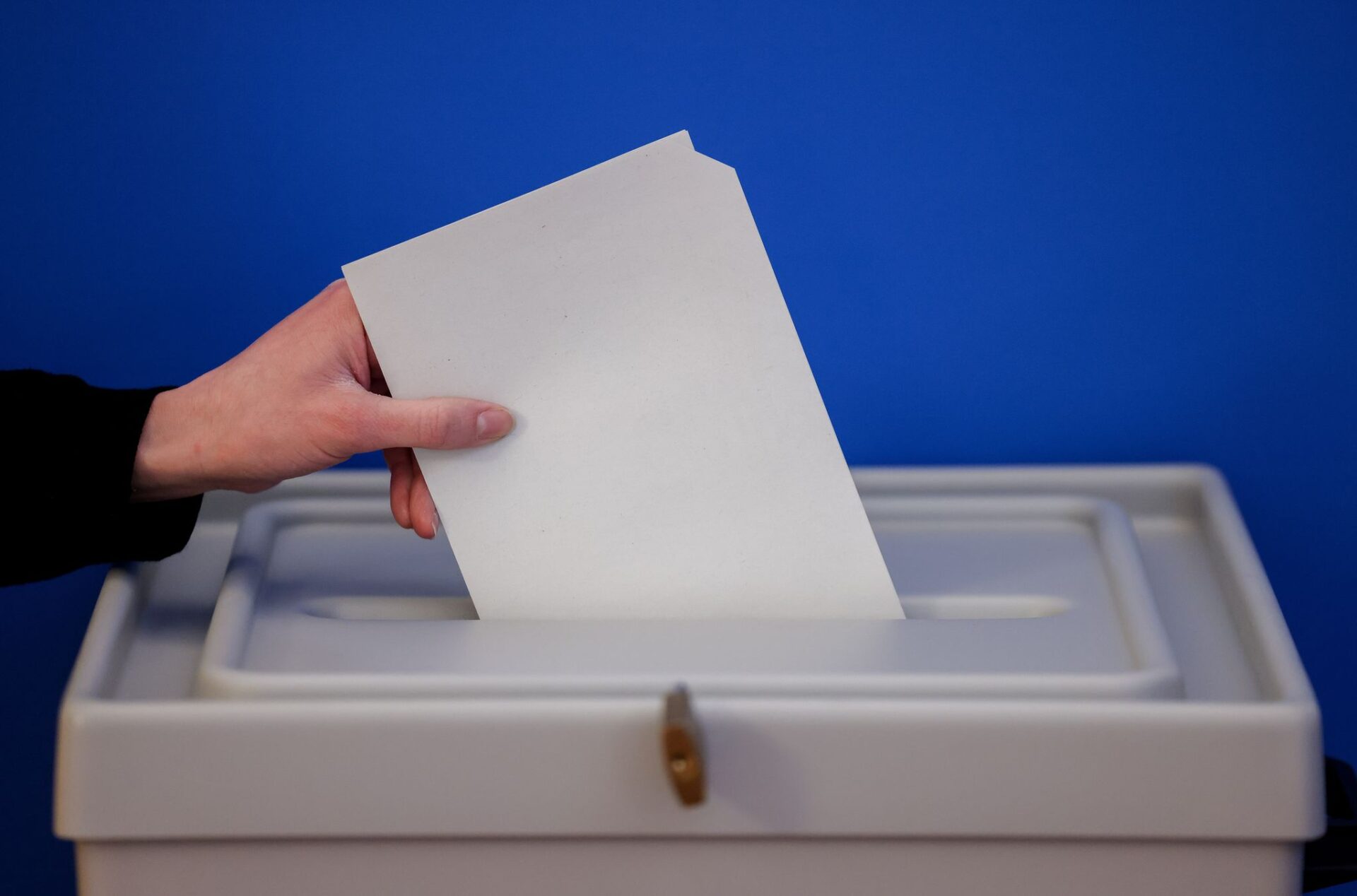Have the article read by OpenAI (Beta). Please note that AI translations may take some time to process.
Have the article read by OpenAI (Beta). Please note that AI translations may take some time to process.2024 war ein Wahljahr von großer globaler Dimension mit Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in 74 Ländern und Ergebnissen quer durch das politische Spektrum.
Es gab jedoch auch einige Gemeinsamkeiten, wie etwa den durchschnittlichen Anstieg der Wahlbeteiligung oder auch die Tendenz, Regierungsparteien an den Urnen abzustrafen.
In einigen Ländern brachten die Wahlen noch nie dagewesene Ergebnisse: In Mexiko und Nordmazedonien zum Beispiel traten in diesem Jahr erstmals Präsidentinnen ihr Amt an. In Rumänien wurden die Präsidentschaftswahlen nach der ersten Runde annulliert, was ebenfalls ein historisches Novum gewesen ist.
Europawahlen – ein Rechtsruck
Die Europawahlen im Juni waren eine der wichtigsten Wahlen im Jahr 2024. Sie haben ein neues Europäisches Parlament hervorgebracht, das weiter nach rechts gerückt ist – und damit eine konservativere Tendenz in vielen Ländern der EU widerspiegelt. Außerdem wurde eine Europäische Kommission gewählt, die stärker denn je von der Mitte-Rechts-Gruppe Europäischen Volkspartei (EVP) dominiert wird.
Das Europäische Zentrum für Populismus-Studien weist in einem aktuellen Bericht darauf hin, dass bei den Wahlen im Juni nicht weniger als 60 populistische Parteien aus 26 EU-Mitgliedstaaten ins Europäische Parlament gewählt wurden, während es im Jahr 2019 40 Parteien aus 22 Ländern waren.
Die Konsolidierung der populistischen Rechten hat sich bei den Europawahlen und den nationalen Wahlen im Jahr 2024 in Europa bestätigt. Immer mehr rechtsextreme Parteien sind Teil von Koalitionen, wie in den Niederlanden, oder stellen ein wichtiges Gewicht in der Machtbalance dar.
Dem Bericht zufolge hat sich die populistische Rechte in praktisch allen Mitgliedstaaten etabliert und hat in Ländern wie Frankreich, Deutschland, Österreich, Rumänien und den Niederlanden besonders gut abgeschnitten.
Eine Annullierung, ein Antrag auf eine Annullierung, vorgezogene Wahlen und politische Unruhen
In einer historischen Premiere wurden die rumänischen Wahlen nach Berichten über russische Einmischung in den Wahlprozess Anfang Dezember für ungültig erklärt. In Bulgarien waren die Bürger zum siebten Mal in nur vier Jahren zur Wahl aufgerufen, und auch in den beiden größten EU-Volkswirtschaften – Deutschland und Frankreich – gab es politische Unruhen.
Kürzlich haben die Rumänen in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen gewählt, die der pro-russische Calin Georgescu überraschend gewann. Nach diesem Ergebnis wurde der gesamte Wahlprozess am 6. Dezember, zwei Tage vor dem zweiten Wahlgang, vom rumänischen Verfassungsgerichtshof (CCR) für ungültig erklärt. Die Stimmabgabe im Ausland hatte bereits begonnen.
Nachrichtendienste berichteten, Rumänien sei ein Ziel für “aggressive russische Hybrid-Aktionen” , und das Gericht argumentierte, der gesamte Wahlprozess sei fehlerhaft gewesen. Laut dem CCR wurden die Wähler in einer Wahlkampagne vor der Wahl falsch informiert. Ein Kandidat profitierte demnach von aggressiver Werbung, die die Wahlregeln umging, sowie vom Missbrauch der Algorithmen von Social-Media-Plattformen.
Im Jahr 2024 fanden in Bulgarien die sechsten und siebten Parlamentswahlen innerhalb von vier Jahren statt. Die Verhandlungen zur Regierungsbildung dauern an. Während die proeuropäischen Koalitionen GERB-UDF und CC-DB die beiden größten politischen Kräfte bleiben, kam die rechtsextreme Partei Vazrazhdane mit über 13 Prozent auf den dritten Platz und lag damit weniger als einen Prozentpunkt hinter der CC-DB. Die Partei gab nach den Wahlen im Juni auch ihr Debüt im Europäischen Parlament mit drei Abgeordneten, die der rechtsextremen Fraktion “Europa der souveränen Nationen” beitraten.
Anfang November eröffnete das bulgarische Verfassungsgericht ein Verfahren, in dem die Rechtmäßigkeit der Wahl von Abgeordneten in mehr als 50 Wahlsektionen bei den Wahlen im Oktober angefochten wird. In der Petition, die von Mitgliedern der ehemaligen Nationalversammlung eingereicht wurde, wird auf angebliche Verstöße während des Wahlvorgangs hingewiesen, darunter Stimmenkauf, manipulierte Stimmenauszählung, Übertragung von Stimmen von einer Partei auf eine andere und das Fehlen der vorgeschriebenen Videoüberwachung der Stimmauszählung.

In Frankreich, der zweitgrößten EU-Volkswirtschaft, folgte die politische Instabilität auf die vorgezogenen Parlamentswahlen. Diese hat der französische Präsident Emmanuel Macron im Juni angesetzt, nachdem die Rechtsextremen bei den Europawahlen stark abgeschnitten hatten. Während die rechtsextreme Rassemblement Nationale (RN) die erste Runde der Parlamentswahlen gewann, erlitt sie in der zweiten Runde eine Niederlage durch Wahlbündnisse zwischen der Linken und Macrons Zentristen. Am 13. Dezember ernannte Macron den Zentristen François Bayrou zum Premierminister und übertrug ihm die schwierige Aufgabe, Frankreich aus einer monatelangen politischen Krise zu führen.
Er wurde ernannt, kurz nachdem das Parlament die Regierung des ehemaligen Premierministers Michel Barnier in einem historischen Misstrauensvotum nach einem Patt über einen Sparhaushalt abgesetzt hatte. Bayrou ist der sechste Premierminister in Macrons Amtszeit und der vierte Premierminister Frankreichs im Jahr 2024.
Im Nachbarland Deutschland verlor Bundeskanzler Olaf Scholz am 16. Dezember eine Vertrauensabstimmung im Parlament und ebnete damit den Weg für vorgezogene Neuwahlen im Februar. Die könnten seine Amtszeit an der Spitze der größten europäischen Volkswirtschaft beenden und die Konservativen wieder an die Macht bringen.
Scholz forderte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier umgehend auf, das Parlament aufzulösen – der nächste Schritt auf dem Weg zu Neuwahlen, etwa sieben Monate früher als ursprünglich geplant. Der Bundespräsident hat 21 Tage Zeit, um diese Entscheidung zu treffen, ein Schritt, der als Formalität gilt.
Auch wenn Scholz wie erwartet verloren hat, war es das Ergebnis, das er angestrebt hatte. Seine Koalition zerbrach nach monatelangen heftigen Auseinandersetzungen darüber, wie die kränkelnde deutsche Wirtschaft saniert und das Milliardenloch im Haushalt 2025 geschlossen werden soll.
Scholz wurde bereits zum SPD-Spitzenkandidaten ernannt, obwohl seine Partei in aktuellen Umfragen hinter der konservativen CDU/CSU und der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland (AfD) auf dem dritten Platz liegt.
In Österreich hat sich die rechtsextreme Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) in diesem Jahr als stärkste politische Kraft des Landes etabliert. Sie gewann die Europawahlen mit 25,4 Prozent und dann auch die Parlamentswahlen im September mit fast 29 Prozent. Die Partei ist jedoch noch weit von der Macht entfernt, da drei andere Parteien – die konservative Österreichische Volkspartei (ÖVP), die sozialdemokratische SPÖ und die liberalen Neos – eine Koalition bilden wollen. Die Koalition soll im Januar nächsten Jahres mit der Regierungsarbeit beginnen, sofern sie eine Einigung erzielt.
In Kroatien gab es im Gegensatz zu einigen anderen EU-Mitgliedstaaten keine größeren Veränderungen, die Lage ist nach wie vor stabil. Mitte April fanden Parlamentswahlen statt. Einen Monat später wurde eine neue Regierung gebildet. An deren Spitze steht zum dritten Mal Ministerpräsident Andrej Plenković (HDZ, Mitte-Rechts), der dieses Amt seit 2016 innehat. Am 29. Dezember werden die Kroaten in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen erneut an die Urnen gehen. Sollte kein Kandidat eine absolute Mehrheit erlangen, wird die zweite Runde am 12. Januar abgehalten.
Wahlen in der EU-Nachbarschaft und auf der ganzen Welt
Im Vereinigten Königreich, das bis 2020 Mitglied der EU war, kehrte die Labour-Partei nach 14 Jahren konservativer Regierung mit Keir Starmer als Premierminister an die Spitze zurück.
In Nordmazedonien fanden im Frühjahr Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt. Die Konservative Gordana Siljanovska Davkova (VMRO-DPMNE) wurde die erste Präsidentin des Landes. Das Wahlbündnis „Dein Mazedonien“ der VMRO-DPMNE unter der Führung von Hristijan Mickoski gewann und drängte die DUI-Partei, die 16 Jahre lang in wechselnden Koalitionen an der Macht gewesen war, in die Opposition.
Die ehemalige Sowjetrepublik Georgien, die an der Schnittstelle zwischen Europa und Asien liegt, wurde vom Musterschüler der Europäischen Union im postsowjetischen Raum zum Schlusslicht in der Beitrittsliste. Nach einem Annäherungsprozess, der vor fast zwei Jahrzehnten eingeleitet wurde, beschloss Tiflis, die Verhandlungen über den EU-Beitritt einzufrieren, was zu Massenprotesten führte.
Die Spannungen gehen auf das Jahr 2023 zurück, als das Parlament begann, ein Gesetz nach russischem Vorbild über die „Transparenz ausländischer Einflussnahme“ zu diskutieren. Die Situation verschärfte sich, nachdem die seit 2012 regierende pro-russische Partei „Georgischer Traum“ die Parlamentswahlen im Oktober gewonnen hatte. Der Sieg wurde von der Opposition und dem Westen nicht anerkannt, die Wahlbetrug anprangerten.
Die politischen Unruhen verschärften sich, nachdem Tiflis beschlossen hatte, den Dialog mit der EU einzufrieren, massive Pro-EU-Proteste unterdrückte und den pro-russischen Michail Kawelaschwili per Parlamentsabstimmung zum Präsidenten wählte.
Auch im EU-Beitrittskandidatenland Moldawien fanden Wahlen statt. Der pro-westliche moldauische Präsident Maia Sandu wurde für eine zweite Amtszeit bestätigt. Sandus Herausforderer, Alexandr Stoianoglo, der als pro-russischer Kandidat galt, erhielt rund 45 % der Stimmen.
Die Wahlbeteiligung in dem zwischen der EU und Russland hin- und hergerissenen Land war höher als im ersten Wahlgang am 20. Oktober, an dem sich mehr als 54 % der Wähler beteiligten. Der Wahltag wurde von Vorwürfen der russischen Einmischung seitens Sandu und ihres nationalen Sicherheitsberaters Stanislav Secrieru begleitet. Die EU warf Russland eine „beispiellose“ Einmischung in die Wahlen in Moldawien vor, die als eine der wichtigsten in der postsowjetischen Geschichte des Landes angesehen werden.
Aber nicht nur in Europa sind die Bürgerinnen und Bürger zu den Urnen gerufen worden: In Indien, dem bevölkerungsreichsten Land der Welt, fanden Parlamentswahlen statt – ein Prozess, der so umfangreich war, dass er anderthalb Monate dauerte. In Mexiko trat mit Claudia Sheinbaum erstmals eine Frau das Präsidentenamt an. Aber auch jenseits der nördlichen Grenze, in den USA, wurden Präsidentschaftswahlen abgehalten, mit dem Ergebniss, dass Donald Trump im Januar 2025 ins Oval Office zurückkehren wird. Dies löste viele Diskussionen über die Zukunft der Beziehungen zwischen der EU und den USA aus.
*Dieser Artikel enthält keine komplette Liste aller Wahlen im Jahr 2024, sondern ist eine Auswahl der Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, die am European Newsroom (enr) teilnehmen und deren Berichterstattung über Wahlen in Europa. Der European Newsroom hat in der Vergangenheit eine Key Story zu den Wahlen in Georgien und Moldawien erstellt, die Sie hier finden können.
Dieser Artikel wird zweimal pro Woche veröffentlicht. Der Inhalt basiert auf den Nachrichten der am European Newsroom beteiligten Agenturen.